THEMA 2020
SABINE RIEDEL
Die Mehrsprachigkeit ist Europas kulturelles Erbe. Wie gehen die Länder mit diesem Potential um? Fördern sie die Mehrsprachigkeit und wenn ja mit welchem Ziel? Eine Sprachenpolitik kann die gesellschaftliche Integration und eine gute Nachbarschaft fördern. Wie die Geschichte Europas zeigt, kann sie aber auch dazu dienen, Streit zwischen verschiedenen Sprachgemeinschaften zu säen. So rechtfertigen sezessionistische Bewegungen ihre Forderungen nach einem eigenen Staat meist mit der kulturellen und sprachlichen Unterschieden. Entspricht dieses Bild überhaupt der Realität oder profitieren die Menschen nicht schon immer von ihrer individuellen Mehrsprachigkeit? Wie kann die Politik verhindern, dass die Sprachen zum Zankapfel um den Zugang zu öffentlichen Ämtern wird?

Wiesbaden 2015, S. 10 und 15f., zum Buch >
AUSZUG AUS: SABINE RIEDEL: DIE KULTURELLE ZUKUNFT EUROPAS, 2015
»2.1.2 Wiederbelebungsversuche: Vom Mythos zur Kulturnation
Das wachsende Interesse gebildeter Schichten am griechischen Kulturerbe führte bald zur Frage nach dem Schicksal ihrer Nachkommen. Die Tatsache, dass die Peloponnes noch im Jahre 1821 Teil des Osmanischen Imperiums war, empörte die Philhellenen, d. h. die Griechenlandfreunde in ganz Europa, und machte sie sensibel für die Idee der Befreiung von der vierhundert Jahre währenden „Türkenherrschaft“. Deshalb brachen Hunderte aus ganz Westeuropa zum Mittelmeer auf, um den dort beginnenden Freiheitskampf zu unterstützen. Viele fanden dabei den Tod wie z. B. der bekannte britische Dichter Lord Byron of Rochdale, der wie kein anderer das romantische Ideal der Kulturnation personifizierte. Danach sei es das Recht eines jeden Volkes, als dessen einigendes Band die gemeinsame Muttersprache betrachtet wurde, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und sich gewaltsam gegen die Fremdherrschaft zu erheben. Diese galt als eigentliche Ursache für die Vermischung von Sprachen und Kulturen und hätte im Falle Griechenlands zur Dekadenz und schließlich zum Niedergang geführt. Deshalb strebten die Griechenfreunde in erster Linie nach der „Wiedergeburt“ der griechischen Nation nach dem Vorbild des Altertums. Eine Ablösung der absolutistischen Sultansherrschaft gemäß den Idealen der Französischen Revolution stand nicht auf ihrer politischen Agenda. […]
2.1.4 Was sagt die Wissenschaft zu Griechenland als „Wiege Europas“?
Erst Zweifel am antiken Griechenlandbild mit dessen Kontinuitätsthese über zweieinhalb Jahrtausende hinweg übten die Heimkehrer aus den Freiheitskämpfen. Der Berliner Apotheker Karl Emil Rosenstiel gehörte zu jenen Überlebenden, die 1822 ins Mittelmeer aufgebrochen waren, um die Griechen gegen das Osmanische Reich militärisch zu unterstützen. In seinen Memoiren stellte er zwei Jahre später kritisch fest: „Wie wir jedoch alle getäuscht wurden, […] denn leider! ist nur der Boden Griechenlands derselbe, das jetzige Volk der Hellenen aber, auch nicht im entferntesten Sinne jenem alten ähnlich.“ Diese und andere Berichte führten zwar zu öffentlichen Kontroversen, doch der weitere Kriegsverlauf, vor allem die Niederlage bei der Einnahme der Athener Akropolis, mobilisierte die Griechenlandanhänger zusätzlich und ließ die Kritiker verstummen. Schwerer wogen dagegen wissenschaftliche Argumente, die eine direkte Abstammung der heutigen Griechen von den Einwohnern in alter Zeit anzweifelten. Schon 1830 bezeichnete der Orientalist Jakob Philipp Fallmerayer das vorherrschende Griechenlandbild als „leeres Phantom“ und schrieb den viel zitierten Satz: „Denn auch nicht ein Tropfen echten und ungemischten Hellenenblutes fließet in den Adern der christlichen Bevölkerung des heutigen Griechenlands.“
Diese provokante These kostete Fallmerayer den Lehrstuhl an der Münchner Universität, denn sie widersprach dem staatlich verordneten Philhellenismus des bayerischen Königshauses und dessen Regentschaft in Griechenland. Selbst der Altphilologe Friedrich Thiersch, der den jungen Prinzen Otto unterrichtet und dessen Griechenlandbild geprägt hatte, fiel später in Ungnade, weil er die Wiederbelebungsversuche des altgriechischen Kulturerbes nicht zur Rechtfertigung der Restauration, sondern mit den Idealen einer aufgeklärten Monarchie verband.

Dennoch hat seine These von der Kontinuität der griechischen Sprache und Kultur den wissenschaftlichen Diskurs über seine Zeit hinaus bestimmt. Denn seinem Wirken ist es zu verdanken, dass mit der Staatsgründung Griechenlands das Altgriechische zur neuen Amtssprache erklärt wurde [und bis 1976 galt]. Man bezeichnete sie zwar als Katharevousa (gr. καθαρεύουσα – katharévousa – reine Sprache), doch hatte sie nichts mehr mit den Ideen ihres Schöpfer Adamantios Korais zu tun, der Ende des 18. Jahrhunderts eine moderne Bildungssprache schaffen wollte. Sein Bemühen um eine Hochsprache, die von slavischen und osmanischen Fremdwörtern gereinigt war, ging den Philhellenen nicht weit genug. Ihr Vorbild blieb die attische Sprachnorm des Altertums, d. h. eine archaische Grammatik, die sich nicht über die Jahrhunderte im täglichen Sprachgebrauch abgeschliffen hatte. […]«
Wie das obige Zitat anschaulich beschreibt, wurde das Modell der Kulturnation Anfang des 19. Jahrhunderts entworfen. Es behauptet, dass alle heutigen Nationen aus Sprachgemeinschaften hervorgegangen seien, deren Existenz bis ins Altertum zurückverfolgt werden könne. Dieses Modell stand ganz im Dienst der Herrschaftssicherung europäischer Monarchen, die teils noch ohne Verfassungen, d. h. absolutistisch, regierten. Mit dem Modell der Kulturnation bekämpften sie nicht nur die politische Willensnation mit den Idealen aus der Französischen Revolution. Es eignete sich auch zur Destabilisierung benachbarter Imperien: Denn damit konnten sie deren sprachliche Diversität aufdecken und behaupten, dass jede Sprachgemeinschaft eine Nation sei, die einen eigenen Staat besitzen müsse.
Die unten stehende Abbildung veranschaulicht, wie diese These aus sprachwissenschaftlicher Sicht zu betrachten ist: Sprache ist nicht gleich Sprache. Erst durch soziale oder politische Vereinbarungen entwickeln sie sich zu normierten Standard- bzw. Amtssprachen. Zudem unterliegen sie einem permanenten Entwicklungsprozess.

Vgl. die Abbildungen in: (zum Buch >)
SABINE RIEDEL: DIE ERFINDUNG DER BALKANVÖLKER, VS-VERLAG, WIESBADEN 2005, S. 43
Die Entdeckung der kulturellen bzw. sprachlichen Vielfalt in der europäischen Staatenwelt des 19. Jahrhunderts war sicherlich ein großer Wissensfortschritt. Doch aus der Einführung technologischer Neuerungen wissen wir heute, dass damit auch Missbrauch betrieben werden kann, wenn das Wissen in falsche Hände gerät oder für zweifelhafte Interessen genutzt wird. So verstanden es die europäischen Diktatoren des 20. Jahrhunderts, die jungen Demokratien und ihre Staaten mithilfe des Kulturnationsmodells zu zerschlagen: Sowohl der deutsche Nationalsozialismus wie auch der Stalinismus sowjetischer Prägung griffen Elemente des Austromarxismus auf, wonach sich die Bevölkerung kulturell in Mehrheiten und (nationale) Minderheiten aufteilen lasse. Entlang diesen Kulturgrenzen sollten die politischen Mitspracherechte verteilt werden. Adolf Hitler machte jedoch aus dem ursprünglich positiv gedachten Minderheitenschutz ein diskriminierendes und rassistisches System zur Vernichtung von Minderheiten in ganz Europa.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zwar die Ursachen und Folgen der nationalsozialistischen Ideologie gründlich analysiert. Doch die verhängnisvolle Verbindung von kultureller, sprachlicher oder religiöser Zugehörigkeit und politischen Rechten wurde speziell in den sozialistischen Staaten Osteuropas nicht aufgelöst. Im Gegenteil hielt sie mehr und mehr Einzug in deren politische Systeme und Verfassungen. Neben der Sowjetunion und Jugoslawien ist die Tschechoslowakei hierfür ein anschauliches Beispiel: Sie wurde als Staat des „tschechoslowakischen Volkes“ (Verf. 1920), d. h. als politische Willensnation, gegründet, deren Bürger unabhängig von ihrer kulturellen bzw. sprachlichen Orientierung gleichgestellt waren, auch wenn es in der Praxis dagegen Verstöße gab. Die Nationalsozialisten hielten jedoch die Tschechoslowakei für ein „künstliches Gebilde“, teilten das Territorium unter ihrer Herrschaft nach ethnischen Kriterien auf und rechneten es zum „Lebensraum des deutschen Volkes“ (1939).

Im Jahre 1948 wurde zwar die Tschechoslowakei als Staat wiederhergestellt, jedoch nicht das „tschechoslowakische Volk“ als politische Willensnation. Die neue Verfassung bezeichnet „Tschechen und Slowaken [als] zwei Brudernationen, Mitglieder der großen Familie des Slawentums“, die schon seit einem Jahrtausend unter dem Christentum als gemeinsamer Kultur zusammenleben (Verf. 1948). Von Minderheiten ist erst Jahre später die Rede, nämlich als „Bürger ungarischer, ukrainischer und polnischer Nationalität“ (Verf. 1960); die deutschsprachige Minderheit erhielt dagegen keinerlei Rechte. Als Reaktion auf den Prager Frühling verabschiedete das Regime schließlich eine neue Verfassung (1968), in der „das tschechische und slowakische Volk“ ein unveräußerliches „Selbstbestimmungsrecht“ erhielten. Dies war die rechtliche Grundlage zur Auflösung der Tschechoslowakei im Jahre 1992.
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts lehrt uns, dass insbesondere autoritäre Staaten das Kulturnationsmodell zu ihrer Herrschaftssicherung missbrauchen. Sie behaupteten eine kulturelle, sprachliche oder religiöse Homogenität von Staaten, die sie politisch steuerten. Dazu gehörte nicht nur die Verfolgung, Unterdrückung oder Diskriminierung von sprachlichen oder anderen Minderheiten. Eine weitaus subtilere Form war und ist heutzutage die Schaffung von Minderheiten durch das Kulturnationsmodell und deren politische Teilhabe an der staatlichen Macht. Das Beispiel der ehemals sozialistischen Systeme Osteuropas macht deutlich, dass die Minderheitenpolitik nicht per se einen demokratischen Ansatz folgt. Vielmehr muss sie dafür erst bestimmte Kriterien des internationalen Menschenrechtsstandards erfüllen (vgl. unten).
AUSZUG AUS: SABINE RIEDEL: AMBIVALENZEN DES MINDERHEITENSCHUTZES, INTERNATIONALE ORGANISATIONEN AUF DEM PRÜFSTAND,
in: Osteuropa, 57. Jg., 11/2007, S. 57-65, zum Artikel >
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts haben die internationalen Organisationen in Europa den Minderheitenschutz ausgebaut und dabei einen neuen gruppenrechtlichen Minderheitenschutz etabliert. Er basiert auf dem Modell der Kulturnation und unterteilt die Bevölkerung der Staaten nach kulturellen Kriterien, d.h. sprachlichen oder religiösen, in Mehrheiten und Minderheiten.
In diesem Artikel aus dem Jahre 2007 wird die Lage in der Republik Makedonien, in Serbien/Kosovo, Belgien und Frankreich analysiert und gezeigt, dass weder der OSZE-Kommissar für nationale Minderheiten noch der Europarat mit diesem neuen Instrument die interethnischen Spannungen lösen konnten. Stattdessen schufen sie ein asymmetrisches Schutzsystem mit unterschiedlichen rechtlichen Standards. Das zog unweigerlich Forderungen nach weiteren Minderheitenrechten nach sich, sodass neue gesellschaftliche Konfliktpotentiale entstanden sind. So ist es z. B. den Staaten selbst überlassen, welche Gruppen sie als „nationale Minderheiten“ anerkennen. Einig sind sie sich lediglich darin, dass Migranten nicht darunter fallen.
Die konzeptionellen Schwächen des derzeitigen Minderheitenschutzes könnten durch eine Rückkoppelung an den individuellen Menschenrechtsschutz korrigiert werden, wie er vom Europarat und der Europäischen Union entwickelt wurde. Er basiert auf dem politischen Nationsmodell und ist auch ohne den problematischen Begriff „Minderheit“ wirksam.
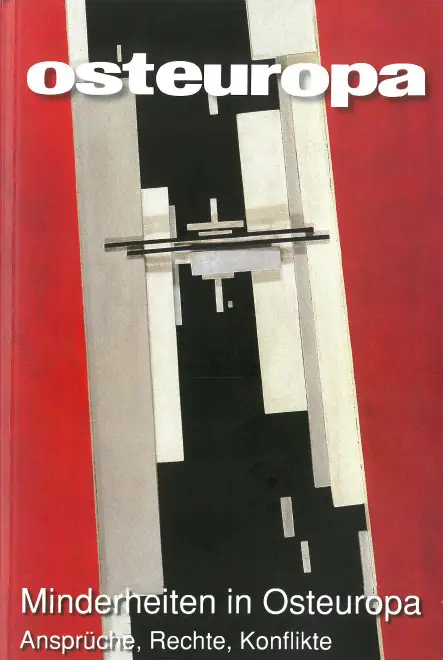
Ansprachen zum ungarischen »Tag der nationalen Zusammengehörigkeit« am 4. Juni 2011 anlässlich des Jahrestags des Friedensvertrags von Trianon (4. Juni 1920)
László Kövér, Parlamentspräsident, Budapest:
»Am heutigen Tag betrauern wir nicht nur unsere in Trianon [1919] erfolgte Zerstückelung, sondern feiern unser Überleben, den Neuanfang und den Zusammenhalt der Ungarn. […] Es gibt keine inner- und außerungarischen Angelegenheiten, sondern nur ungarische Angelegenheiten. In diesem Sinne müssen wir unsere geistigen, seelischen und materiellen Ressourcen konzentrieren und den ungarischen Staat neu errichten.«
Zsolt Németh, Staatssekretär im Außenministerium, Budapest:
»Vor einem Jahr haben viele nicht geglaubt, dass dies gelingen könnte. Am heutigen Tag gibt es aber bereits mehrere Tausend, die den gesetzlichen Weg zum Erwerb oder Wiedererwerb der ungarischen Staatsangehörigkeit beschritten haben. […] Ein neuer Wind weht im Karpaten-Becken [Rumäniens], der Wind des Zusammenhalts und des gemeinsamen Aufstiegs […]. Dies ist eine Leistung, auf die wir stolz sein können und eine Basis, auf die wir bauen können.«
Zitiert nach: SABINE RIEDEL, DOPPELTE STAATSBÜRGERSCHAFTEN ALS KONFLIKTPOTENTIAL. Nationale Divergenzen unter europäischer Flagge, SWP-Studie, S. 24, Berlin, Oktober 2012. Dortige Quelle: Budapester Zeitung, 10.6.2011, zur SWP-Studie >
Bereits die Aufteilung der Bevölkerung in Mehrheiten und Minderheiten basiert auf der irrtümlichen Behauptung, dass dies nach sprachlichen Kriterien so einfach möglich sei. Die von Wissenschaftlern zitierten Volksbefragungen verweisen nur auf Angaben zur Muttersprache. Hiervon eine Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit abzuleiten, ist eine sozialpolitisch motivierte Interpretation. Häufig werden die Angehörigen von Sprachminderheiten gar nicht gefragt, ob sie sich überhaupt einer Minderheit zugehörig fühlen oder dazu gehören wollen.
Im Gegenteil erwachsen gerade aus dieser offiziell zugewiesenen Minderheitenrolle neue gesellschaftliche Konflikte: Die Minderheit, die per Definition nicht zur offiziellen Kulturnation (oder „Titularnation“) gerechnet wird, will selbst Teil einer Mehrheit sein und fordert daher die Veränderung von Staatsgrenzen. Dass es damit aber auch nicht getan ist, darauf verweist das Phänomen der Mehrsprachigkeit, besonders in jenen Regionen, wo Sprachminderheiten leben. Das spricht letztlich gegen Grenzrevisionen, weil dadurch nur neue Minderheiten entstehen.
Die Mehrsprachigkeit ist auch ein Indiz dafür, dass die Angehörigen von „Minderheiten“ meist der offiziellen Amtssprache mächtig sind. Dies bringt aber die Methode der Aufteilung der politischen Nation eines Staates in verschiedene Sprachgruppen und Kulturnationen ins Zwielicht. Selbst bei noch so gut ausgestatteten Gruppenrechten bleibt die Minderheit eben eine Minderheit und von der Möglichkeit ausgeschlossen, sich zu integrieren. Die heute populären Maßnahmen der positiven Diskriminierung gießen weiter Öl ins Feuer und erzeugen Neid.
Wie das Zitat aus einer Rede des ungarischen Parlamentspräsidenten (s. links) verdeutlicht, sorgt der gruppenrechtliche Minderheitenschutz auch für Streit zwischen den Staaten in Europa und selbst zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Danach können sich Staaten wie Ungarn, Rumänien, Bulgarien oder Kroatien zu sogenannten Schutzmächten für nationale Minderheiten in den Nachbarländern aufschwingen. Das vereinigende Band derselben Muttersprache über Staatsgrenzen hinweg reicht ihnen aus, um von derselben Nationszugehörigkeit zu sprechen.
Dabei haben die Staatsangehörigen der Slowakei, Serbiens oder Rumäniens, die Ungarisch als Muttersprache sprechen, nie in einem ungarischen Staat gelebt. Deren Vorfahren waren Untertanen der vielsprachigen Donaumonarchie. Mit deren Umwandlung in Österreich-Ungarn (1867) erhielten nur die Sprachminderheiten in der westlichen Reichshälfte Autonomierechte. In der ungarischen Reichshälfte blieb die Verwendung anderer Sprachen dagegen untersagt, um die Entstehung einer ungarischen Sprachnation zu forcieren. Wenn Budapest heute Angehörigen „seiner“ Sprachminderheit im Ausland den ungarischen Pass anbietet, knüpft sie an diesen Sprachnationalismus des 19. Jahrhunderts an. Dadurch baut sich innerhalb der Europäischen Union zurzeit ein Konfliktpotential auf, das die EU-Kommission im Beitrittsprozess unterschätzt hatte und sogar bis heute weitgehend ignoriert. Nur der Europarat hat sich bisher dieser Probleme angenommen und Lösungsvorschläge unterbreitet (vgl. die SWP-Studie 2012, links).
DAS BEISPIEL DES KATALANISCHEN SPRACHNATIONALISMUS:
Die Gleichsetzung von Muttersprache und nationaler Zugehörigkeit nach dem Kulturnationsmodell des 19. Jahrhunderts ist auch in Westeuropa zu beobachten, so z. B. in Spanien. Über vier Jahrzehnte hinweg propagierte die Franco-Diktatur unter der Bezeichnung Hispanidad – Hispanität – die Einheit zwischen Sprache und Nation und unterdrückte damit den sprachlichen Pluralismus der spanischen Bevölkerung.
Erst nach Francos Tod (1975) wurde dieses Kulturnationsmodell durch die neue demokratische Verfassung (1978) zugunsten einer spanischen Willensnation aufgegeben: Alle spanischen Regionen erhielten nun das Recht auf die Pflege ihrer kulturellen und sprachlichen Besonderheiten. Hieraus entstand Anfang der 1980er Jahre ein Autonomiesystem mit insgesamt 17 autonomen Gemeinschaften (s. Abb. 4).

Obwohl die autonome Gemeinschaft Kataloniens als erste Region ein Autonomiestatut mit der Zentralregierung aushandeln konnte und unter allen spanischen Regionen den höchsten Stand an Selbstverwaltungsrechten genießt, gibt sie sich mit ihrer Autonomie nicht zufrieden: Bereits seit 2005 fordert Barcelona die Anerkennung der Katalanen als eigene Nation, deren Existenz von der katalanischen Sprache und damit vom Kulturnationsmodell abgeleitet wird. Seit 2010 geht es der Regionalregierung um die staatliche Unabhängigkeit.
Auch in diesem Fall besteht zwischen dem Anspruch der katalanischen Sprachnation und der gesellschaftlichen Realität eine große Diskrepanz: Denn das Katalanische konnte sich erst seit der demokratischen Wende frei entwickeln. Noch 1975 beherrschten es nur 14,5 Prozent in Wort und Schrift, heute sind es 83,2 Prozent der Einwohner Kataloniens. Um der Forderung nach Eigenstaatlichkeit Nachdruck zu verleihen, bevorzugte die Regionalregierung allmählich das Katalanische als offizielle Amtssprache und verdrängte das Spanische auf den zweiten Platz.
Dieser Sprachnationalismus sorgt nicht nur innerhalb Kataloniens für Spannungen, sondern beeinträchtigt auch das Verhältnis zu den unmittelbar benachbarten autonomen Gemeinschaften Spaniens, insbesondere mit Valencia im Südwesten, den Balearen im Osten und Aragonien an der westlichen Grenze zu Katalonien. Ihre Regionalsprachen stehen dem Katalanischen sehr nahe, sodass katalanische Nationalisten die angrenzenden Sprachgebiete als „katalanische Länder“ und damit als Teil Kataloniens betrachten. Selbst Andorra und Teile Südfrankreichs werden dazugerechnet (vgl. unten).
Die 17 Autonomen Gemeinschaften Spaniens
Autonomiestatute der Autonomen Gemeinschaften (Datum ihrer Einführung)
| 18.12.1979 | Baskenland |
| Katalonien | |
| 06.04.1981 | Galicien |
| 30.12.1981 | Andalusien |
| Asturien | |
| Kantabrien | |
| 09.06.1982 | La Rioja |
| Murcia | |
| 01.07.1982 | Valencia |
| 10.08.1982 | Aragonien |
| Kanarische Inseln | |
| Kastilien-La Mancha | |
| Navarra | |
| 25.02.1983 | Balearen |
| Extremadura | |
| Kastilien-León | |
| Madrid |

Vgl. die Abbildung und weitere Analysen dazu:
SABINE RIEDEL, DIE BEFRAGUNG ZUR UNABHÄNGIGKEIT KATALONIENS (9.11.2014). ERGEBNISSE, HINTERGRÜNDE UND HERAUSFORDERUNGEN FÜR EUROPA,
in: Arbeitspapiere FG Globale Fragen, 2014/Nr. 03, November 2014, S. 10, zum SWP-Arbeitspapier >
Vgl. das online-paper vom 18. August 2017:
SABINE RIEDEL, KATALONIEN IST NUR DER ANFANG … STEIGENDES KONFLIKTPOTENTIAL VON UNABHÄNGIGKEITSBEWEGUNGEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION,
in: Forschungshorizonte Politik & Kultur, August 2017, zum online-paper >
Vgl. das online-paper vom 10. Januar 2018:
SABINE RIEDEL, KATALONIEN IM BRENNGLAS DER EU-KRISEN. DAS PATT NACH DEN REGIONALWAHLEN VOM 21.12.2017 IST EIN SIGNAL AN EUROPAS REFORMER,
in: Forschungshorizonte Politik & Kultur, Januar 2018, zum online-paper >
DAS BEISPIEL DES KATALANISCHEN SPRACHNATIONALISMUS:
Die katalanische und andere separatistische Bewegungen in Europa bedienen sich neben dem Sprachnationalismus einer weiteren Strategie, um ihre Eigenstaatlichkeit zu rechtfertigen: Sie instrumentalisieren den Prozess der Regionalisierung, der im Jahre 1985 mit der Gründung der Versammlung der Regionen Europas (VRE) begann. Seit 1994 wird er vom Ausschuss der Regionen (AdR) der Europäischen Union unterstützt und umfasst heute 350 lokale und regionale Gebietskörperschaften aus 28 EU-Mitgliedstaaten.
Einige Wissenschaftler wie z. B. aus dem Salzburger Institut der Regionen Europas (IRE) oder auch Parteienvertreter des Europaparlaments wie die der Europäischen Freien Allianz (EFA) schlagen die Auflösung der großen EU-Mitgliedsstaaten vor, weil diese angeblich „künstliche“ Gebilde darstellen. Sie bestünden aus mehreren Sprachgemeinschaften, die nach dem Kulturnationsmodell als Nationen mit dem Recht auf Eigenstaatlichkeit anerkannt werden sollten.

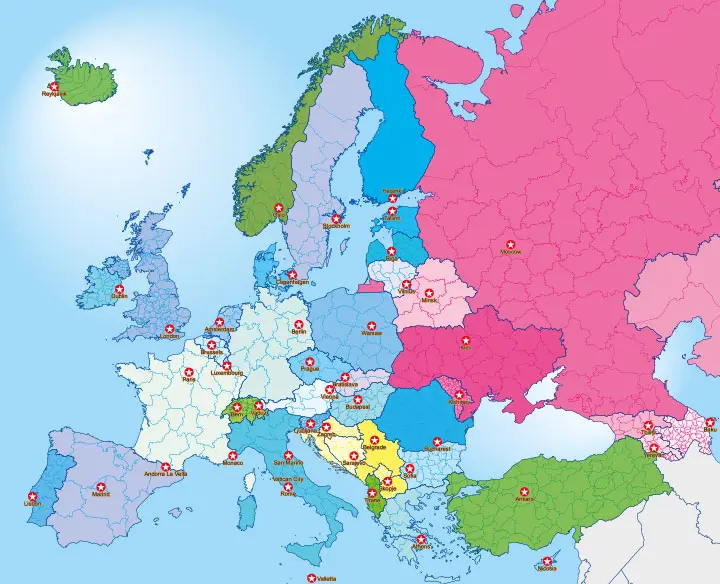
Dieser Prozess wird als „innere EU-Erweiterung“ bezeichnet und als Strategie präsentiert, die aktuellen Sezessionskonflikte z. B. in Spanien, Großbritannien, Italien, Belgien, Rumänien usw. zu lösen. Sie halten das EU-System für fähig, die Zahl der EU-Mitglieder von 28 auf 50, 70 oder noch mehr Staaten zu erhöhen.
Dabei behaupten sie, dass die Gründung und der Zerfall von Staaten ein ganz natürlicher Prozess sei. Dagegen steht die jüngste Erfahrung, dass heute fast alle von Territorialkonflikten gebeutelten Länder und Regionen politisch handlungsunfähig werden oder sogar in einem wirtschaftlichen Ruin versinken.
Vor allem aber stellt sich die Frage nach dem Europakonzept der sezessionistischen Bewegungen. Wo sehen sie das einigende Band, das die Europäische Union dann noch zusammenhalten kann? Schließlich lehnen sie das Modell der Willensnation und des Verfassungsstaats als Ordnungsprinzip ab und wollen den Kontinent in ein politisches System von Staaten umbauen, indem sie sich an kulturellen und sprachlichen Differenzen orientieren.
DAS BEISPIEL DES KATALANISCHEN SPRACHNATIONALISMUS:
„Wie die griechischen Freiheitskämpfer, so hatten sich schon Anfang des 19. Jahrhunderts auch die Serben gegen die Osmanenherrschaft aufgelehnt. Denn die Romantik hatte Philhellenen wie Panslavisten mit dem Gedanken beflügelt, dass die Muttersprache das einigende Band einer gemeinsamen Volksseele sei. Der serbische Freiheitskampf wurde jedoch nicht mit dem gleichen Engagement von den Großmächten unterstützt wie jener der Griechen, sodass Serbien zwischen 1813 und 1878 zunächst noch ein autonomes und vom Sultan abhängiges Fürstentum blieb. Europas Monarchen erkannten nämlich im wachsenden Identitätsbewusstsein der Slaven ihres Herrschaftsgebiets eine große Gefahr für ihre eigene absolutistische Macht: In Russland stellten sie die Mehrheit der Bevölkerung, in Preußen und der Habsburgermonarchie betrug ihr Anteil bis zu 40 Prozent, nicht zuletzt infolge der mehrfachen Aufteilung des Königreichs Polen-Litauen.“ (Vgl. SABINE RIEDEL: DIE KULTURELLE ZUKUNFT EUROPAS, Wiesbaden 2015, S. 19).
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts griffen die russischen Zaren die „slavische Idee“ bzw. den panslavischen Nationalismus auf und machten ihn neben Orthodoxie und Autokratie zu ihrer Herrschaftsdoktrin. Damit setze sich der Streit der europäischen Großmächte um die kulturelle Einflussnahme auf die Bevölkerung der Balkanhalbinsel fort. Dabei vertrieben sie die Osmanen mit unterschiedlichen Strategien: Während Russland mit Serbien und Bulgarien erste slavischsprachige Pufferstaaten schuf, entschied sich die Donaumonarchie für die Annexion des noch stark muslimisch geprägten Bosnien-Hercegovina (1908). Beide ebneten so den Weg für zwei Balkankriege (1912/13), die kurz darauf in den Ersten Weltkrieg mündeten.
Dieser Nations- und Staatsbildungsprozess nach dem Kultur- bzw. Sprachnationsmodell blieb für Südosteuropa das gesamte 20. Jahrhundert hindurch das bestimmende Muster. Selbst nach dem Ende des Kalten Kriegs (1990) gelang es dem westlichen Europa nicht, sein Modell der politischen Willensnation, die auf den Werten demokratischer Verfassungen basiert, als Alternative anzubieten, um die kulturell zerstrittenen Gesellschaften und Staaten in Südosteuropa zu befrieden. Im Gegenteil gewann nun der religiöse Faktor für die Nationsbildungsprozesse an Bedeutung, was vor allem die islamisch geprägte Staatenwelt zur politischen Einflussnahme nutzt. Wird die EU die balkanischen Klein(st)staaten mit ihren Konfliktmustern aufnehmen, dann wird dies tatsächlich einen Prozess einer „inneren Erweiterung“ der EU in Gang setzen
Eine ganze Reihe von Balkanexperten behauptet, dass die Uhren in Südosteuropa ganz anders gingen und das Modell der politischen Willensnation dort keine Basis in der Bevölkerung hätte. Diese Behauptung ist empirisch nicht hinreichend belegt und spielt zudem den dortigen Eliten in die Hände, die von dem Kulturnationsmodell und ihren Klein(st)staaten profitieren. Während die staatlichen Institutionen ihre Bevölkerung mit einer Sprachpolitik drangsalieren, die linguistische Unterschiede betont und neue Amtssprachen schafft, setzen sich auf dem Balkan Unternehmer zusammen, um auf Englisch, Russisch, Französisch oder Deutsch ihre Geschäfte zu machen.
Nachdenklich stimmt, dass sich sogar in der europäischen Metropole Brüssel ähnliche Tendenzen hin zu einer sprachlichen Ausdifferenzierung und Abschottung zeigen. Dort kämpfen seit geraumer Zeit die flämische und französische Sprachgemeinschaft gegeneinander um den Verlauf der Sprachgrenzen im öffentlichen Raum. Heute steht auch dieses Land mit seiner Bevölkerung vor einer politischen Spaltung und einem Zerfall nach dem Modell der Kulturnation.
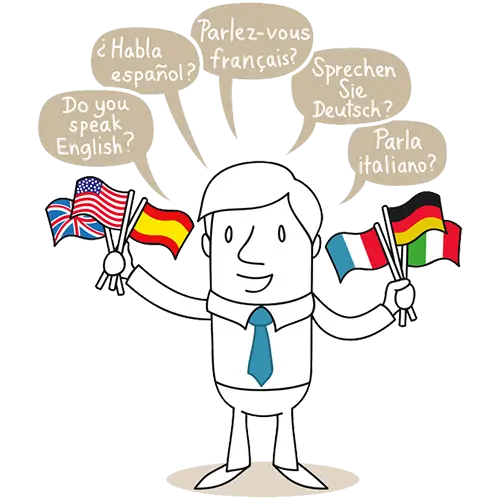
„Ein vielversprechender Ansatz zur Lösung derartiger Spannungen ist hingegen die Förderung der Mehrsprachigkeit im Rahmen politischer Willensnationen, wie sie durch den europäischen Integrationsprozess angestoßen wurde. Hier geht es nicht mehr um kulturelle Ab- oder Ausgrenzungen und nicht mehr um die leidige Diskussion über die Machtverteilung zwischen sprachlichen Mehrheiten und Minderheiten, sondern um die Sprachkompetenzen aller EU-Bürger und damit um einen ganz und gar integrativen Ansatz im Rahmen nationaler Bildungspolitiken. Aus verschiedenen Gründen hat die Osterweiterung einen wesentlichen Beitrag zur Popularisierung dieses Ansatzes der Mehrsprachigkeit geleistet. So ergaben jüngere Untersuchungen über die Fremdsprachenkenntnisse der EU-Abgeordneten (MdEP), dass gerade die Parlamentarier aus den neuen Mitgliedstaaten sehr viel Kompetenzen mitbringen: […].
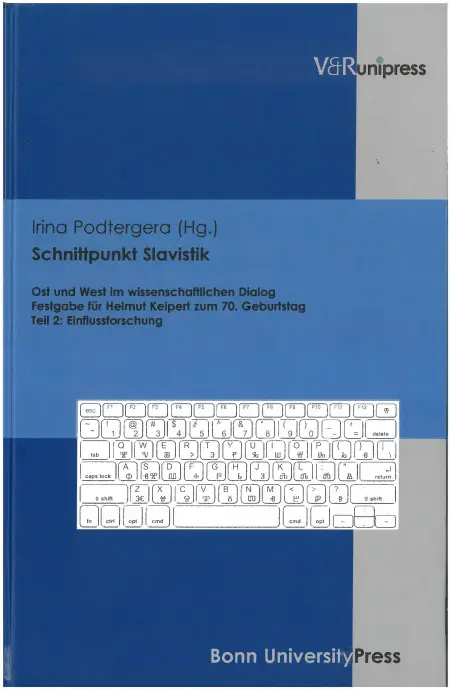
Noch steht die Europäische Union mit ihrer Strategie zur Förderung der Mehrsprachigkeit ganz am Anfang, denn nicht alle Mitgliedstaaten unterstützen aus voller Überzeugung diese Initiative. Dies hat nicht zuletzt damit zu tun, dass es trotz vieler Fortschritte bei der Integration noch keinen europäischen Kommunikationsraum jenseits der nationalen Ebene gibt und deshalb in manchen Ländern die Einsicht für eine gemeinsame Strategie fehlt. Erst eine Kooperation einzelner nationaler Medien mit dem Ziel, dieselben Programme mehrsprachig zu senden, könnte längerfristig eine europäische Öffentlichkeit schaffen, die EU-weit multilingual über europäische Themen debattiert. Einen ersten Schritt hierzu hat das Europaparlament unternommen, indem es über Internet die Plenarsitzungen und Anhörungen live überträgt und dabei sämtliche Übersetzungen zur Verfügung stellt, die von den Dolmetscherdiensten für die 23 Amtssprachen angeboten werden. Hier bekommt man eine Vorstellung davon, was es bedeutet, die europäische Sprachenpolitik nach demokratischen Kriterien auszurichten. Es bedarf eines sehr großen materiellen und ideellen Einsatzes, um jedem Abgeordneten das Recht zu garantieren, seine Redebeiträge in seiner Muttersprache zu präsentieren und dabei vom vielsprachigen Publikum auch verstanden zu werden. Mit dieser bereits institutionalisierten Mehrsprachigkeit sind einer Umfrage aus dem Jahre 2007 zufolge 64 Prozent der Europaabgeordneten zufrieden, wobei 60 Prozent gegen wenige Amtssprachen als Alternative votierten. Das Konzept der Mehrsprachigkeit scheint sich offenbar auch als ein Korrektiv anzubieten, um Tendenzen einer zunehmenden Zentralisierung und Bürokratisierung der EU-Institutionen entgegenzuwirken.“
VGL. SABINE RIEDEL: DIE SLAVIA DIE BEFRAGUNG ZUR UNABHÄNGIGKEIT KATALONIENS (9.11.2014), IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN EUROPÄISCHER INTEGRATION UND NATIONALER SELBSTBESTIMMUNG,
in: Irina Podtergera (Hg.), Schnittpunkt Slavistik, Ost und West im wissenschaftlichen Dialog, Teil 2: Einflussforschung, Bonn 2012, S. 211-234, zum Artikel >